Nikolai Sinai; Vom Interesse an islamischer Philosophie bis hin zu umfangreichen vergleichenden Studien zum Koran
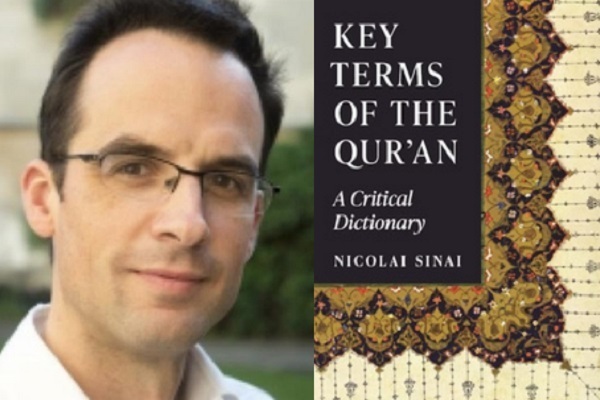
IQNA:Koranstudien im Westen gingen mit der Veröffentlichung von Noldekes Geschichte des Korans in den Jahren 1276–1277 Hijri/1860 n. Chr. in eine neue Phase ein. Aufgrund der Vollständigkeit seiner Koranthemen war dieses Buch für westliche Forscher sehr effektiv bei der Auseinandersetzung mit Koranstudien.
Ab Beginn der 1950er Jahre stellten Koranstudien Veränderungen hinsichtlich der Aufmerksamkeit für Interpretationsfragen fest. Die Veränderungen, die sich aus den modernen Tendenzen der Exegese ergaben, die in Ägypten begannen, erfreuten sich bei Orientalisten großer Beliebtheit. Auch westliche Korangelehrte widmeten der wissenschaftlichen und literarischen Exegese in Ägypten Aufmerksamkeit. Einer der bedeutendsten Forscher, die auf diesem Gebiet schrieben, war Jacques Joumier. Er sprach über Tafsir al-Manar, geschrieben von Mohammad Rashidreza (gestorben 1935), basierend auf den Reden von Mohammad Abdah (gest. 1905) und den Ansichten von Amin Khouli (Begründer der literarischen Interpretation der Koranbewegung in Ägypten), Al-Jawahir fi Tafsir al-Qur'an Tantawi, Essenz wissenschaftlicher Interpretationen und Bewegung einer Koran-Exegese aus Ägypten schrieb einen Artikel zwischen 1951-1947. Die wichtigste exegetische Forschung im frühen 20. Jahrhundert war nach Noldekes Buch «Geschichte des Korans» «Trends in Islamic Interpretation» von Ignats Goldziher. Johannes Marinus Simon Balion hat bei der Vervollständigung des letzten Kapitels von Goldzihers Buch die exegetische Bewegung Ägyptens zwischen 1880 und 1960 untersucht. Eine Monographie über Kommentatoren ist eine der anderen interpretativen Forschungen der Orientalisten.
In den letzten Jahrzehnten arbeiteten viele Forscher an westlichen Universitäten im Bereich der Koranstudien. Einer dieser herausragenden Forscher ist Nicolai Sinai, deutscher Professor für Islamwissenschaft an der Universität Oxford. Sinai wurde 1976 in Deutschland geboren. Er studierte Arabisch und Philosophie an der Universität Leipzig, der Freien Universität Berlin und der Universität Kairo. Er promovierte 2007 an der Freien Universität Berlin.
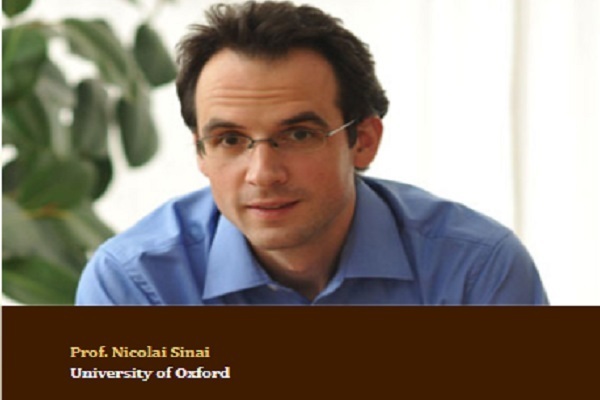
Interesse an literarischen und interreligiösen Aspekten des Korans
Seit 2011 lehrt er als Dozent, außerordentlicher Professor und Professor Islamwissenschaften an der Universität Oxford. Seine Forschungsschwerpunkte sind historisch-kritische Koranstudien sowie islamische Philosophie und Theologie. Generell gilt sein Interessengebiet den literarischen Aspekten des Korans, Herangehensweise des Korans im Umgang mit jüdischen und christlichen Traditionen und seiner Beziehung zur altarabischen Poesie, dem spätantiken Arabien und dem Leben Mohammeds (sas), Koran-Exegese, sowohl vormoderne als auch moderne, Hermeneutik im Allgemeinen, Geschichte des philosophischen und theologischen Denkens in der islamischen Welt.
Saynai schreibt über seine Studien und sein Lieblingsgebiet in den Koranstudien: Der Großteil meiner bisherigen Forschung bezieht sich auf die Frühzeit des Islam, insbesondere auf den Koran und das Leben von Muhammad (sas). Er befasste sich eingehend mit den literarischen Merkmalen des Korans, seiner inneren Chronologie und seiner Wechselwirkung mit früheren Traditionen (biblische, christliche, rabbinische, arabische Traditionen). Ihn interessiert die Frage der Positionierung früher arabischer Texte im multikulturellen, multireligiösen und mehrsprachigen Umfeld, in dem sie entstanden sind.
Er fügt hinzu: Zusätzlich zu meinem Interesse daran zu untersuchen wie der Koran von seinem ersten Publikum verstanden wurde, untersuche ich die Komplexität und sprachliche Wissen von mehr als tausend Jahren Interpretation der islamischen Bibel und bin fasziniert davon, wie die Kommentatoren des Korans kombinieren oft mehrere Disziplinen wie Syntax, Textkritik und Rhetorik. Ich interessiere mich auch sehr für die Geistesgeschichte des islamischen Mittelalters, insbesondere für die arabische Philosophie. In meinen Vorlesungen, Vorträgen und Seminaren lege ich Wert auf die sorgfältige Lektüre vormoderner Primärquellen und eine strenge textbasierte Argumentation. Ich leite derzeit ein vom Europäischen Forschungsrat unterstütztes Forschungsprojekt mit dem Titel „Tafseer Qur'an: A Coherent Paradigm“ und bin Herausgeber der Zeitschrift der International Qur'anic Studies Association.
Das Projekt „Qur'anic Interpretation: A Coherent Paradigm“, abgekürzt als QuCIP, wird die kritische Grundlage für den ersten historisch-kritischen Kommentar zu einem Teil des Korans in englischer Sprache liefern, der mindestens das erste und zweite Kapitel abdeckt. Ziel dieses Projekts ist die Bereitstellung eines integrierten Interpretationsansatzes, der drei Hauptdimensionen ansprechen kann, darunter: 1- enge und gleichzeitig selektive theologische Interaktion mit früheren Konzepten und Traditionen (jüdische, christliche und altarabische). 2- Untersuchung der komplexen Kompositionsstruktur, insbesondere erweiterter Suren des Korans, wie etwa die Suren Al-Baqarah und Al-Imran. 3- Komplexe Prozesse der literarischen Entwicklung und der von ihnen geprägte Reformverlauf.
In diesem Projekt wird die vormoderne islamische Forschung zum Koran als wertvoller Schatz aus der sorgfältigen Lektüre dieses heiligen Buches kritisch untersucht. Der erste Meilenstein dieses Projekts war ein erklärendes Wörterbuch der Schlüsselbegriffe des Korans. Dieses Wörterbuch und andere Werke von Mitgliedern dieses Projekts werden die Grundlage für Interpretationen zur Grammatik des Korans, zur Syntax des Korans in seinem antiken Kontext und zu Aspekten der Geschichte der frühen Rezeption des Korans bilden.
Sinais Theorie über Ende der Kollektion des Korans
Eine von Sainas Ansichten, die die Aufmerksamkeit von Koranforschern auf sich zog ist seine Sicht über die endgültige Zusammenstellung des Heiligen Korans. Er schreibt darüber: Meine Behauptung, dass die Standardform des Korans bis etwa 30 n.H. erstellt wurde und Uthman ihn zum Standardtext erklärte, trifft immer noch auf die meisten Korangelehrten zu, die auf Englisch, Französisch oder Deutsch schreiben. Aber im letzten Jahrzehnt wurden wichtigere Arbeiten zu den frühen Manuskripten des Korans und den ersten schriftlichen Überlieferungen des Korans, den Traditionen der Lektüre des Korans und den Konsequenzen der etablierten Koranschrift durchgeführt für das Verständnis der sprachlichen Merkmale des Koranarabischs. Beispielsweise hat Marin Van Putten die Schreibweise des Ausdrucks „Nama't/Namat Allah“ in vierzehn frühen Manuskripten des Korans untersucht und festgestellt, dass deren konsistente Verwendung von „offenem t“ oder „geschlossenem t“ an denselben Stellen des Korans impliziert, dass alle diese Versionen von einem Schrift-Archetyp stammen.
Er fügt hinzu: Generell halte ich die meisten der in meiner Arbeit von 2014 dargelegten Argumente auch im Lichte neuerer Arbeiten immer noch für gültig. Einschließlich meines Versuchs zu zeigen, dass einige interne Merkmale des Korans nicht ohne weiteres mit der Hypothese vereinbar sind, dass der Text des Korans am Ende der Herrschaft von Abdul Malik erstellt wurde.
Er erklärt weiter: Wie ich im Artikel von 2014 sagte, füge ich auch hinzu, dass die historische Forschung die Hypothese nicht zurückweisen kann, dass einige Korrekturen und Ergänzungen am Korantext etwa im ersten Jahrzehnt nach dem Tod des Propheten vorgenommen wurden. „Kann nicht ausgeschlossen werden“ soll bedeuten, dass ich nicht sicher bin, ob es ein positives Argument für die Idee gibt.
Man kann mit Sicherheit sagen, dass mein Artikel nicht alle überzeugt hat. Gelehrte wie Steven Shoemaker behaupten immer noch, dass der Standardtext des Korans wahrscheinlich zur Zeit von Abd al-Malik zusammengestellt und veröffentlicht wurde und dass ein Großteil seines Inhalts nicht eine wörtliche Widerspiegelung der Botschaften Mohammeds im ersten Buch ist Jahrzehnte seiner Da'wah. Ich glaube immer noch, dass das Modell von Shoemaker große Probleme hat! Das bedeutet, dass der Erklärungsrahmen, den dieses Modell für die Vervollständigung des Korans bietet, nicht so zufriedenstellend ist wie das traditionelle Szenario. Dem traditionellen Szenario zufolge wurde der Korantext hauptsächlich vor der Eroberungszeit in Mekka und Medina offenbart und bis etwa 30 n. H. standardisiert.
Koranisch-islamische Forschungen von Nikolai Sinai
Dieser deutsche Forscher verfasste mehrere Bücher und Dutzende Artikel auf dem Gebiet der Koranstudien, von denen die meisten Aufmerksamkeit von Experten auf diesem Gebiet erregten. Seine wichtigsten Werke sind:
1- Fortschreibung und Auslegung: Studien zur frühen Koraninterpretation, Wiesbaden 2009 (324 pp)
2- Der Koran. Eine Einführung. Reclam, Stuttgart (2017)
3- The Qur'an. A Historical-Critical Introduction . Edinburgh (2017)،
4- Rain-Giver, Bone-Breaker, Score-Settler: Allāh in Pre-Quranic Poetry (2019)
5- Unlocking the Medinan Qur’an (ed.), Brill (2022)
6- Key Terms of the Qur'an. A Critical Dictionary. Princeton (2023)
Das Buch „Key Terms of the Qur'an. A Critical Dictionary.“ wurde von Korangelehrten begrüßt. Dieses Buch bietet eine umfassende und interdisziplinäre Analyse einer großen Anzahl wichtiger koranischer Begriffe. Bei diesen Begriffen handelt es sich um analytische Einträge zu wichtigen Koranphrasen. Von Namen Gottes (wie «Allah» und «Rahman») bis hin zum koranischen Verständnis der Konzepte des Glaubens und Gottesdienst gibt es eine Reihe von Begriffen, die in diesem Buch besprochen werden.
Zu jedem Begriff erörtert Sinai, was er im koranischen Gebrauch bedeutet, wie er ins Englische übersetzt werden sollte und welche Rolle er in der Weltanschauung und dem klaren Bild des Korans von Gott, dem Menschen und der Welt spielt. Er bietet außerdem einen umfassenden Überblick über die Beziehung der koranischen Terminologie zu früheren Traditionen (wie jüdischer und christlicher Literatur, vorislamischer arabischer Poesie und arabischen Epitaphien). Eine Rezension, die zwar umfassend, aber nicht reduktionistisch ist.
Dieses Glossar versucht vor allem zu zeigen, was der Koran durch die Verwendung der einzelnen Begriffe für sein Hauptpublikum (späte antike Araber) beabsichtigte. Gleichzeitig hat Sinai neben umfangreichen englischen, deutschen und französischen Studien aus dem 19. Jahrhundert auch selektiv und kritisch die Werke späterer Muslime genutzt.
Michael Cook, Professor an der Princeton University, schreibt über diese Arbeit: Ein solches Nachschlagewerk, das ein erklärendes Wörterbuch ist, erleichtert Forschern der Islamwissenschaft die Arbeit erheblich. Diese Einträge sind wissenschaftlich, fair und inspirierend und vereinen viel gebrauchte Literatur und Erkenntnisse aus den verborgenen Ecken des Fachgebiets.
Ahmad al-Jallad, Professor an der Ohio University, schrieb ebenfalls über dieses Buch: Dieses Buch ist ein wichtiges Werk für das akademische Studium des Korans. Sinai bietet einen detaillierten Überblick über den Wortschatz des Korans und befasst sich gleichzeitig mit einem breiten Spektrum historischer Forschung zum Text des Korans und seinem historischen Kontext.
Gabriel Reynolds, Professor an der University of Notre Dame, schrieb in einer Rezension dieser Arbeit: In dem Buch „Key Terms of the Qur'an“ kombiniert Sinai ein sorgfältiges Studium des Korantextes mit Erkenntnissen aus dem Islam Interpretationen, Spätantike, Tradition des alten und neuen Testaments und neueste zeitgenössische Forschung. Dieses Buch sollte auf dem Schreibtisch eines jeden Koranstudenten und -forschers liegen.
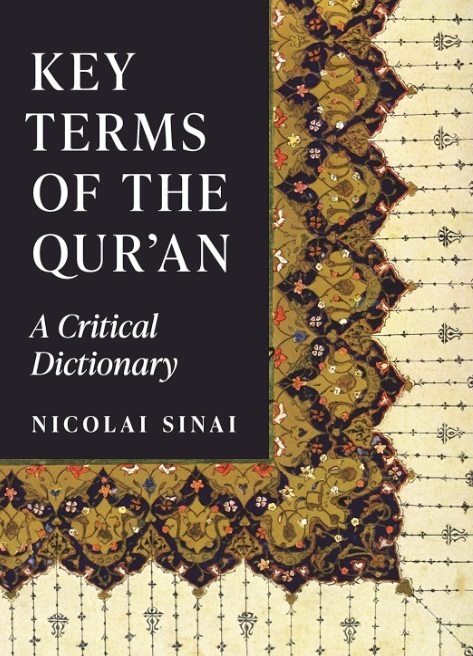
Zusätzlich zu den genannten Büchern veröffentlichte er Dutzende Artikel in verschiedenen Magazinen und Büchern veröffentlicht, darunter:
– “The Christian Elephant in the Meccan Room: Dye, Tesei, and Shoemaker on the Date of the Qurʾān”,Journal of the International Qur’anic Studies Association 2024
“Introduction”, in Unlocking the Medinan Qur’an, edited by Nicolai Sinai, Leiden: Brill, 2022, 1-12
– “Towards a Compositional Grammar of the Medinan Suras”, in Unlocking the Medinan Qur’an, edited by Nicolai Sinai, Leiden: Brill, 2022, 15-56
– “Towards a Redactional History of the Medinan Qur’an: A Case Study of Sūrat al-Nisāʾ (Q 4) and Sūrat al-Māʾidah (Q 5)”, in Structural Dividers in the Qur’an, edited by Marianna Klar, Abingdon: Routledge, 2021, 365-402
– “Beyond the Cairo Edition: On the Study of Early Quranic Codices”, review essay on Asma Hilali, The Sanaa Palimpsest: The Transmission of the Qur’an in the First Centuries AH, and Éléonore Cellard (ed.) with the assistance of Sabrina Cimiotti, Codex Amrensis 1, Journal of the American Oriental Society 140, no. 1 (2020): 189-204
– “Inner-Qur’anic Chronology”, in The Oxford Handbook of Qur’anic Studies, edited by Mustafa Shah and Muhammad Abdel Haleem, Oxford: Oxford University Press, 2020, 346-361
– “Historical Criticism and Recent Trends in Western Scholarship on the Qur’an: Some Hermeneutic Reflections”, Journal of [the] College of Sharia & Islamic Studies 38, no. 1 (2020): 136-146
– “Pharaoh’s Submission to God in the Qur’an and in Rabbinic Literature: A Case Study in Qur’anic Intertextuality”, in The Qur’an’s Reformation of Judaism and Christianity, edited by Holger Zellentin, Abingdon: Routledge, 2019, 235-260
– “The Qurʾān’s Dietary Tetralogue: A Diachronic Reconstruction”, Jerusalem Studies in Arabic and Islam 46 (2019): 113-146.
– “Two Types of Inner-Qurʾānic Interpretation”, in Exegetical Crossroads: Understanding Scripture in Judaism, Christianity and Islam in the Pre-Modern Orient, edited by Georges Tamer et al., Berlin: De Gruyter, 2018, 235-288
– “Muḥammad as an Episcopal Figure”, Arabica 65 (2018): 1-30.
– “Inheriting Egypt: The Israelites and the Exodus in the Meccan Qurʾān”, in Islamic Studies Today: Essays in Honor of Andrew Rippin, edited by Majid Daneshgar and Walid Saleh, Leiden: Brill, 2017, 198-214
– “Going Round in Circles”, review essay on Michel Cuypers, The Composition of the Qur’an: Rhetorical Analysis, and Raymond Farrin, Structure and Qur’anic Interpretation: A Study of Symmetry and Coherence in Islam’s Holy Text, Journal of Qur’anic Studies 19, no. 2 (2017): 106-122
„Circling in Circles“, ein analytischer Essay über Michelle Kuipers, Composition of the Qur'an: A Rhetorical Analysis und Raymond Frein, Structure and Commentary of the Qur'an: Examining Symmetry and Coherence in the Sacred Text of Islam.
– “Processes of Literary Growth and Editorial Expansion in Two Medinan Surahs”, in Islam and its Past: Jahiliyya, Late Antiquity, and the Qur’an, edited by Carol Bakhos and Michael Cook, Oxford: Oxford University Press, 2017, 69-0119
– “The Qurān”, in Routledge Handbook on Early Islam, edited by Herbert Berg, New York: Routledge, 2017, 9-24
– “Reading Sūrat al-Anʿām with Muḥammad Rashīd Riḍā and Sayyid Quṭb”, in Reclaiming Islamic Tradition: Modern Interpretations of the Classical Heritage, edited by Elisabeth Kendall and Ahmad Khan, Edinburgh: Edinburgh University Press, 2016, 136-159
– “Al-Suhrawardī’s Philosophy of Illumination and al-Ghazālī”, Archiv für Geschichte der Philosophie 98 (2016): 272-301
– “The Unknown Known: Some Groundwork for Interpreting the Medinan Qur’an”, Mélanges de l'Université Saint-Joseph 66 (2015-2016): 47-96.
– “Historical-Critical Readings of Abrahamic Scriptures”, in The Oxford Handbook of Abrahamic Religions, edited by Adam Silverstein and Guy Stroumsa, Oxford: Oxford University Press, 2015, 209-225
– “Al-Suhrawardī on Mirror Vision and Suspended Images (muthul muʿallaqa)”, Arabic Sciences and Philosophy 25 (2015): 279-197
Bericht von Mohsen Haddadi
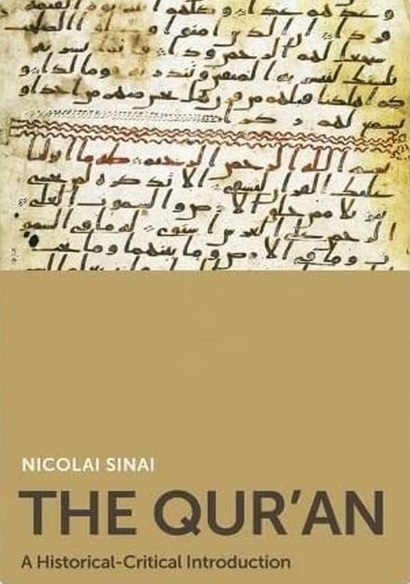
4236440



