Rohingya-Koran: Übersetzung zur Wiederbelebung einer unterdrückten Minderheitensprache
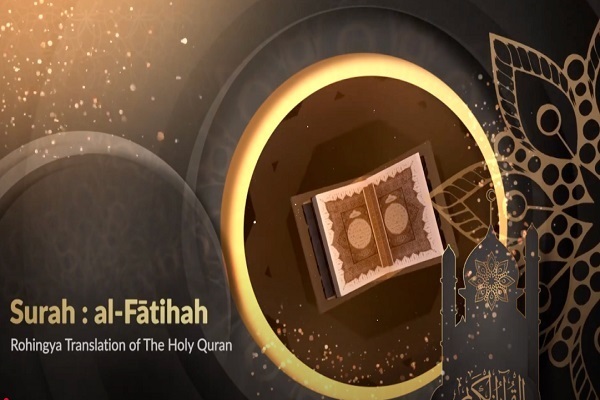
IQNA: Die Rohingya sind eine überwiegend muslimische, indoarische ethnolinguistische Gruppe, die im Rakhine-Staat im Westen Myanmars lebt. Schätzungsweise 1,4 Millionen Rohingya lebten vor dem Völkermord 2017 in Myanmar als mehr als 740.000 nach Bangladesch flohen.
Vor 1989 war der Bundesstaat als Arakan bekannt, dem historischen Namen der Region entlang der nordöstlichen Küste der Bucht von Bengalen zu der auch das heutige Bangladesch gehört. Die 1988 an die Macht gekommene Militärjunta benannte den Bundesstaat um und übernahm bewusst den Namen der überwiegend buddhistischen ethnischen Gruppe der Rakhine, um Myanmar von seinem mehrheitlich muslimischen Nachbarn abzuspalten. Dies war Teil eines rassistischen Projekts zur Staatsbildung und ein weiterer Schritt in einer langen Reihe von Versuchen die Rohingya aus Myanmars Geschichte und Gesellschaft auszulöschen.
Gezielte Bemühungen zur Vernichtung des Rohingya-Volkes
Seit der Machtübernahme der ersten Militärjunta im Jahr 1962 werden den Rohingya systematisch bürgerliche und politische Rechte verweigert unter dem Vorwand sie seien keine echten Burmesen, sondern bangladeschische Staatsbürger und illegale Einwanderer in Myanmar. Sie leiden unter dem Mangel an Bildung, Infrastruktur, Gesundheitsversorgung und wirtschaftlicher Entwicklung, die ihnen allesamt bewusst vorenthalten werden. Die erste Welle gewaltsamer Verfolgung trieb 1978 Hunderttausende zur Flucht nach Bangladesch von denen die meisten später nach einem von den Vereinten Nationen vermittelten Rückführungsabkommen zurückkehren durften.
Das burmesische Staatsangehörigkeitsgesetz von 1982 beschränkte die Staatsbürgerschaft jedoch auf die im Gesetzentwurf ausdrücklich genannten nationalen Rassen. Die Rohingya waren davon ausgeschlossen und wurden somit staatenlos. Weitere staatliche Gewalt gegen die Rohingya ereignete sich 1991/92 und schließlich ab 2012 im größten und systematischsten Versuch der Auslöschung der muslimischen Bevölkerung Myanmars, der 2015 in der Rohingya-Krise gipfelte. Diese koordinierte Kampagne gegen die Rohingya wurde vom Büro des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für Menschenrechte als Völkermord und Verbrechen gegen die Menschlichkeit eingestuft.
Einige Akademiker, Analysten und Politiker, darunter der Nobelpreisträger und südafrikanische Anti-Apartheid-Aktivist Bischof Desmond Tutu, verglichen die Lage der Rohingya in Myanmar mit der Apartheid. Die jüngste Massenvertreibung der Rohingya im Jahr 2017 veranlasste den Internationalen Strafgerichtshof Ermittlungen wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit aufzunehmen und den Internationalen Gerichtshof den Fall als Völkermord einzustufen.
Entwicklung einer standardisierten Rohingya-Schrift
Die Rohingya-Sprache ist eng mit dem Chittagong-Bengali verwandt, das im Osten Bangladeschs gesprochen wird und weniger eng mit dem Standard-Bengalisch. Da die Rohingya überwiegend eine ländliche Bevölkerungsgruppe mit geringen sozialen Bindungen sind wird ihre Sprache eher mündlich als schriftlich verwendet. Während der Kolonialzeit erfolgte die schriftliche Kommunikation üblicherweise auf Englisch oder Urdu, seit der Unabhängigkeit auf Birmanisch.
Als Rohingya geschrieben wurde verwendete man eine nicht standardisierte Variante der persisch-arabischen Schrift. Diese Schrift diente auch als Grundlage für den ersten Versuch im Jahr 1975 eine einheitliche Rohingya-Orthografie zu entwickeln. 1985 schuf der Rohingya-Gelehrte und islamische Lehrer Muhammad Hanif eine eigenständige Schrift, die teilweise vom Arabischen inspiriert war: die Hanif-Rohingya-Schrift. 1999 wurde schließlich eine speziell für Rohingya entwickelte Adaption der lateinischen Schrift vorgeschlagen.
Die Aufnahme der Hanafi-Schrift in den Unicode-Standard im Jahr 2018 war ein bedeutender Meilenstein für die Rohingya, die gegen die Auslöschung ihrer Kultur kämpften. Seit 2019 gibt es auch eine virtuelle Tastatur für die Hanafi-Schrift und Google entwickelte eine Rohingya-Schriftart. Bemerkenswert ist, dass die Hanafi-Schrift nur deshalb entstehen konnte weil Hanif zum Zeitpunkt ihrer Entwicklung in Bangladesch lebte, da die schriftliche Verwendung der Rohingya-Sprache in Myanmar verboten ist. Hanif war entschlossen gegen diesen Versuch die Rohingya-Sprache auszulöschen anzukämpfen.
Er sagte: Wenn ein Volk keine eigene Schriftsprache hat ist es einfacher zu behaupten, dass es als ethnische Gruppe nicht existiert und es ist einfacher es zu unterdrücken!
Die Tatsache, dass die meisten Rohingya in Myanmar, insbesondere jene in Flüchtlingslagern, keinen Zugang zu formaler Bildung haben führt dazu, dass viele sich stattdessen rudimentären islamischen Lehren zuwenden. Allerdings gehen nur wenige Rohingya über grundlegendes religiöses Wissen hinaus und eine ausgeprägte Gelehrtentradition konnte sich nie entwickeln. In einer solchen Gesellschaft ist die Rolle die Koranübersetzungen für den Erhalt bedrohter Kulturen spielen können umso wichtiger.

Koranübersetzungsprojekt für das Volk der Rohingya
Unter diesen Umständen zielt das Rohingya-Koranübersetzungsprojekt darauf ab Wissenslücken über den Islam zu schließen und der Unterdrückung der Rohingya-Sprache entgegenzuwirken. Initiiert wurde das Projekt von Qutub Shah, einem Rohingya, der an der Internationalen Islamischen Universität Malaysia in Vergleichender Religionswissenschaft promoviert. Er kooperierte mit der Dakwah Corner Bookstore, einem missionsorientierten Verlag in Petaling Jaya, einem Vorort von Kuala Lumpur, der sich auf islamische Bildung in englischer Sprache spezialisierte. Da die Rohingya-Sprache kaum schriftlich verwendet wird und daher nur wenige Rohingya sie lesen können, unabhängig von der Schrift entschied sich das Team für den ungewöhnlichen Schritt zunächst eine mündliche Übersetzung des Korans in Rohingya anzubieten, bevor es mit der schriftlichen Übersetzung begann.
Das Übersetzungsteam begann also mit der Erstellung von Audio- und Videomaterialien. Dabei nutzten sie verschiedene Korankommentare und Übersetzungen in Englisch, Urdu, Bengali und Burmesisch, die von der König-Fahd-Gemeinde in Medina veröffentlicht wurden. Die Buchhandlung Dekho Corner hat eine Filiale in Mekka, was sich in der Auswahl der verwendeten Quellen widerspiegelt.
Die Arbeiten an der mündlichen Übersetzung des Korans begannen Anfang 2021 und wurden im August 2023 abgeschlossen. Nutzer können aus professionellen Audio- und Videodateien wählen, die die Rezitation des arabischen Korans mit der mündlichen Übersetzung ins Rohingya kombinieren. Das Projektteam verwendete die Rezitation von Muhammad Ayub, einem in Mekka als Sohn rohingyaischer Flüchtlinge geborenen Religionsgelehrten, der später Imam der Prophetenmoschee (Masjid al-Nabawi) in Medina wurde. Ziel war es daher bereits in der Rezitation eine Verbindung zur Rohingya-Gemeinschaft herzustellen. Die Übersetzung wird von Qutb Shah rezitiert, der auch der ursprüngliche Übersetzer war. Die Audio- und Videodateien sind in der Rohingya-Koran-App für iOS und Android sowie auf der Projektwebsite (https://rohingyaquran.com), auf YouTube und in verschiedenen sozialen Medien verfügbar.
Übersetzung des Korans – Weg zur Wiederbelebung der Rohingya-Sprache
Auf Grundlage mündlicher Übersetzungen wird derzeit eine schriftliche Fassung in hanafitischer Schrift erstellt, die bisher die ersten fünf Suren umfasst. Das Übersetzungsteam berichtete von mehreren Herausforderungen bei der Umsetzung des Projekts, allen voran die Geschichte der Unterdrückung der Rohingya-Sprache. Sie schrieben: Obwohl sich das Schriftsystem Ende der 1970er Jahre entwickelte, wurde seine Verbreitung durch den systematischen Völkermord an den Sprechern der Rohingya gestoppt. Daher gibt es keine Literatur oder intellektuellen Werke in dieser Sprache und sie ist beinahe zu einer leblosen Sprache geworden. Sie wird nur noch für die Bedürfnisse des täglichen Lebens verwendet. In ihrer Heimat war Schreiben verboten und auch die im Exil lebenden Rohingya hatten mit dem Überleben zu kämpfen und wurden von den lokalen Sprachen beeinflusst. Viele Redewendungen verschwanden während andere durch Redewendungen aus anderen Sprachen ersetzt wurden.
Die Übersetzung des Korans in diese Zielsprache war wohl der erste Versuch einen solchen Text ins Rohingya zu übersetzen. Das Problem umfasste drei Aspekte: Übersetzung von Wörtern und Sätzen sowie die flüssige Wiedergabe. Hierfür wurden mehrere Experten mit sprachlichen, kulturellen, geografischen und religiösen Fachkenntnissen hinzugezogen. Manchmal benötigte man mehrere Wörter, eine Phrase oder sogar einen ganzen Satz, um bestimmte Wörter zu übersetzen. Es war eine schwierige, aber letztendlich erfolgreiche Aufgabe. Sie dauerte nur länger als erwartet.
Die Übersetzung ist erläuternd und enthält interpretative Zusätze, sowohl aus den oben genannten linguistischen Gründen als auch aufgrund des dogmatischen Ansatzes des Übersetzungsteams bei der Koranübersetzung. Sie investierten viel Energie in die Entwicklung der technischen Infrastruktur für den Satz der Rohingya-Koranübersetzung, darunter Tastaturlayout und Schriftdesign. Die Buchhandlung Dekuh Corner sammelt derzeit Spenden um das Projekt abzuschließen und 2.000 Exemplare zu drucken und in Malaysia, Bangladesch und Saudi-Arabien zu vertreiben. Die Produktion einer so limitierten Auflage verdeutlicht die Herausforderung der Koranübersetzung in überwiegend mündlich gesprochene Sprachen, was die Entscheidung des Projektteams, professionelle Audio- und Videodateien zu erstellen, umso innovativer und bedeutsamer macht.
In marginalisierten, mehrheitlich muslimischen Gemeinschaften wie den Rohingya besteht das Potenzial für eine Symbiose zwischen Sprachprojekten, Kampagnen zum Erhalt der Kultur und Bemühungen zur Verbreitung und Lehre des Islam. Das Rohingya-Koranprojekt ist nur das jüngste Beispiel dafür, aber aufgrund der Sorgfalt und Professionalität mit der es durchgeführt wurde sicherlich eines der beeindruckendsten. Der Einsatz moderner Technologie wird nicht nur die Verbreitung der Koranübersetzung selbst erleichtern, sondern auch zur Entwicklung und Standardisierung der Rohingya-Sprache beitragen. Dies ist ein hervorragendes Beispiel dafür wie der aktuelle Trend den Koran in immer mehr Sprachen zu übersetzen eine wichtige Rolle für den Erhalt der sprachlichen Vielfalt der Welt spielt.
4299046



